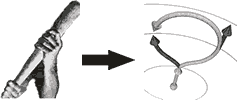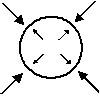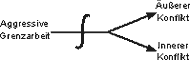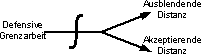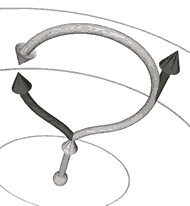Die „Hallenser Biographiestudie zur Jugendgewalt“ wurde von Anja Meyer und mir unter der Leitung von Prof. Dieter Rössner
Mitte der 90er Jahre durchgeführt. Ziel der breit angelegten qualitativen Untersuchung
war es, einen Zugang zur Sinnwelt jugendlicher Gewalttäter zu erarbeiten,
um ihre Orientierung und die Bedeutung ihrer (gewalttätigen) Handlungen
zu verstehen. Zu diesem Zweck wurden über 50 biographisch narrative
Interviews geführt, transkribiert und analysiert. Auf dieser breiten
Basis konnten wir vier Typen entwickeln, die weiter unten ausführlicher
dargestellt werden.
Interviewte Personen
Die Untersuchungsgruppe besteht aus 25 gewaltkriminellen Jugendlichen, die
in Sachsen-Anhalt in Resozialisierungsmaßnahmen eingebunden waren,
in U-Haft oder im Regelvollzug einsaßen. Die wesentlichen Merkmale
dieser Stichprobe (Gewaltbegriff, Alter, Ort) werden somit primär durch
den rechtlichen Maßstab bestimmt. Es sind Jugendliche, die mindestens
ein Opfer körperlich geschädigt bzw. getötet haben und für
diese Tat sanktioniert wurden. Die justitiable Einordnung dieser Personen
zeigt auch deutlich, dass sie schon am Ende der Degradierungsmöglichkeiten
des Staates angelangt sind. Sie blicken alle auf eine lange Reihe von akkumulierten
Ausgrenzungserfahrungen zurück. Vor allem aufgrund der Gerichtsverhandlung
und der folgenden Inhaftierung nimmt bei jedem Einzelnen die Beschäftigung
mit Ausgrenzungserfahrungen einen hohen Stellenwert in der biographischen
Erzählung ein. Wir richteten dementsprechend schon bald den Fokus auf
diese 'Bearbeitung der Ausgrenzungserfahrungen’ als eine gute
Basis für die weiterführende Typisierung.
Neben der Untersuchungsgruppe wurden noch 25 weitere Personen zur Kontrastierung
interviewt. Je nach Analysestand interessierten uns Personen, die unabhängig
von Gewalttaten in starke Ausgrenzungsprozesse involviert waren oder aber
legale Gewalt ausübten. Zur maximalen Kontrastierung zogen wir noch
Jugendliche hinzu, die weder als gewalttätig galten noch starken Ausgrenzungsprozessen
unterlagen. Die Kontrastgruppe umfasst u.a. obdachlose Jugendliche, Punks,
Drogenabhängige, ehemalige Werkhofinsassen, aber auch Boxer, Polizeischüler,
Bundeswehrsoldaten und einen Zivildienstleistenden.
Datenerhebung
In der Datenerhebung haben wir uns am biographisch narrativen Interview
nach Fritz Schütze [1] orientiert. Im Gespräch
steht der Proband eindeutig im Vordergrund. Er ist ein Experte seines Lebens
und erzählt aus diesem Wissensfundus. Der Interviewer signalisiert
primär durch die Rezeptionssignale, dass er interessiert zuhört.
Ist das Narrationspotential ausgeschöpft, wird der Proband durch Nachfragen
zu Argumentationen und Selbstinterpretationen angeregt. Alle Gespräche
werden aufgenommen und genau transkribiert.
Diese Vorgehensweise gibt den
Jugendlichen die Freiräume zur Selbstrepräsentation in ihrer Sprache
und ihrer Dynamik, die für die spätere Analyse benötigt wird.
Nur da, wo die Person tatsächlich etwas von der eigenen Welt preisgibt,
besteht die Möglichkeit an sie heranzukommen.
Dies setzt eine gewisse vertrauensvolle Situation voraus, die unter den
besonderen Bedingungen unserer Interviews nicht selbstverständlich
war. So fanden die meisten Gespräche mit der Untersuchungsgruppe im
Gefängnis statt. Die kargen Aufenthaltsräume oder die Zellen ließen
keinen Zweifel daran, dass die von Misstrauen geprägte Situation in
der totalen Institution immer präsent war.
Außerdem wurde schnell
klar, dass wir es mit interviewerfahrenen und oft auch medienerprobten Jugendlichen
zu tun hatten. Spätestens zur Gerichtsverhandlung wurden sie als auffällige
Jugendliche zu ihrem Leben und zur Gewalt befragt. Sie antworteten mit Fakten,
Daten und v.a. Argumenten und Erklärungen. Diese Befragungen konnten
über ihr weiteres Leben entscheiden und entsprechend wohlüberlegt
mussten sie antworten.
Es gab Probanden, die mit den Anforderungen eines narrativen Interviews überfordert
waren, die, obwohl keine konkreten Fragen gestellt wurden, ihre Argumentationsstränge
präsentierten. Die meisten lösten sich aber davon und ließen
sich von ihrer eigenen Narration treiben.
Um dies zu unterstützen legten
wir im Rahmen des Möglichen viel Wert auf die 'Aufwärmphase':
Das gemeinsame Kaffeekochen, Zigarettenrauchen und die Vorstellung der eigenen
Person und des Projektes konnten für das Gelingen des Interviews entscheidend
sein.
Dabei nahm ein weiterer die Narration hemmender Punkt einen großen
Stellenwert ein. Um den Masterstaus 'Gewalttäter’ nicht von vornherein
zu bestätigen, hatten wir bewusst den Fokus der Gespräche nicht
auf die Gewalttat gesetzt. Es war klar, dass sich die argumentativen Passagen
ansonsten noch ausgeprägter zeigen würden.
Die Probanden gingen
aber oft mit genau dieser Erwartung in das Gespräch. Diese 'erwartete
Gewalterwartung’ musste vorsichtig entkräftet und hin zu einer
Konzentration auf das eigene Leben gelenkt werden.
Die Interviews mit den Personen der Kontrastgruppe fanden meist unter einfacheren
Bedingungen statt. Hier konnten wir den Kontakt selbst gestalten und den
Ort mit den Personen aushandeln.
Auswertung
Die Auswertung erfolgt auf drei Ebenen, die eng miteinander zusammenhängen,
sich aber nicht eindeutig voneinander ableiten: Forschungsprozess, Biographien
und Typen.
Der Forschungsprozess ist nicht starr vorgegeben, sondern entwickelt sich
in der Interaktion zwischen Forscher und Forschungsobjekt. Zu Beginn der
Studie stand die grobe Fragestellung nach der Bedeutung von Gewalt bei Jugendlichen,
die selbst Täter sind und die den Zusammenbruch der DDR noch miterlebt
haben. Dies bestimmte unsere Stichprobe und den Fokus. Aber schon nach einigen
Interviews wurde klar, dass wir die Bedeutung der Wende völlig überschätzt
und die der Ausgrenzung unterschätzt hatten. Unser Fokus, die Fragestellung
und die Stichprobe wurden dem angepasst. Gerade in dieser Flexibilität
liegt auch ein Vorteil der qualitativen Herangehensweise. Die Dynamik kann
beschrieben und analysiert werden.
Stärker im Vordergrund steht in unserer Studie aber die Analyse der
Biographien. Alle transkribierten Interviews wurden in einem größeren
Kreis aus Institutsangestellten und interessierten Personen besprochen.
So konnten strukturelle und inhaltliche Unklarheiten geklärt und weiterführende
Fragen thematisiert werden. Auf dieser Basis wurden einige Interviews für
eine vertiefende Analyse ausgewählt und zu einer biographischen Gesamtdarstellung
geführt. Hier werden die Perspektive des Erzählers, seine Bedeutungswelten,
Orientierungs- und Handlungsmuster herausgearbeitet. Dabei wird besonderer
Wert auf die individuellen Prozessstrukturen gelegt. Sie geben meist das
Gerüst vor, das die Biographie in ihrer wesentlichen Dynamik charakterisiert.
Neben dieser den individuellen Eigenheiten gerecht werdenden Darstellung
stehen die überindividuellen Typen. Ausgangspunkt der Typisierung ist
die Hauptkategorie, die sich aus der Fokussierung, also dem eigenen Interesse
und dem vorliegenden Datenmaterial, ableitet. Für die Probanden hat
sich die Ausgrenzungserfahrung im Zuge der Inhaftierung extrem zugespitzt.
Sie haben auf spektakuläre Weise mitbekommen, dass die die gesellschaftliche
Normalität repräsentierenden Institutionen sie als Gewalttäter
problematisieren und entsprechend sanktionieren. Von dem Kontakt mit der
Polizei über die Gerichtsverhandlung bis hin zum Bezug der Zelle sehen
sie sich in einer einfachen Konstellation verortet: ihnen steht die gesellschaftliche
Normalität gegenüber, die sie als Gewalttäter außerhalb
dieses Bereiches stellt.
Interessanterweise wird diese Verortung von den Probanden übernommen.
Egal wie sie im Einzelnen die staatlichen Institutionen beurteilen, die
Definitionshoheit dessen, was zur gesellschaftlichen Norm gehört und
was nicht, wird von ihnen nicht in Frage gestellt. Die Probanden unterscheiden
sich aber untereinander in der Art und Weise, wie sie diese Position des
ausgegrenzten Gewalttäters interpretieren und in ihr Selbstbild integrieren.
Dies führt zur Hauptkategorie 'Ausgrenzungsbearbeitung’,
die sowohl einen guten Zugang zu den Biographien, als auch zur jeweiligen
Bedeutung der angewandten Gewalt bildet. Anhand der Kontrastierung mehrerer
Merkmale kristallisieren sich die vier Typen heraus, die hier in wesentlichen
Aspekten charakterisiert werden. Zur Veranschaulichung beziehe ich dabei
auch einige Biographien beispielhaft mit ein.
|